Im ersten Teil dieses zweiteiligen Blogartikels haben wir die Folgen der massiven Kürzungen öffentlicher Mittel für gemeinnützige Organisationen analysiert. Dabei wurde deutlich: Fördermittel- und Fundraising-Verantwortliche sowie Führungskräfte stehen zunehmend unter Druck, denn sie müssen steigenden Erwartungen gerecht werden – und das bei gleichzeitig schrumpfenden Ressourcen.
Doch wie lässt sich mit dieser herausfordernden Lage konstruktiv umgehen? In diesem zweiten Teil richten wir den Blick nach vorn: Ich stelle Ihnen zwei praxisnahe Checklisten-Tools vor, die dabei helfen, strategische Lösungsansätze zu entwickeln und Fundraising als festen Bestandteil Ihrer Organisationsentwicklung zu verankern. Denn eines ist klar: Fördermittel- und Spenden-Fundraising ist kein Notnagel, sondern eine zentrale Zukunftsaufgabe.
Tool 1: Fundraising strategisch ausrichten – So analysieren Sie den Handlungsbedarf Ihrer Organisation
Die Ausgangslage ist je nach Organisation sehr unterschiedlich, abhängig von den bisherigen Fundraising-Erfahrungen, der Haltung der Beteiligten sowie vom Grad der finanziellen Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln.
Wenn Sie die Rolle des Fundraisings in Ihrer Organisation nachhaltig verändern möchten (weg vom „Lückenfüller“ hin zu einem strategischen Finanzierungsbaustein), ist es sinnvoll, zunächst die eigene Ausgangssituation systematisch zu analysieren.
Im ersten Teil dieser Blogserie habe ich die strukturellen Problemfelder beschrieben, die sich aus den drastischen Kürzungen öffentlicher Fördergelder ergeben. Aufbauend darauf habe ich eine Checkliste entwickelt, mit der Sie die aktuelle Fundraising-Situation Ihrer Organisation reflektieren und gezielt Ansatzpunkte für Veränderungen identifizieren können.
Der Fördermarkt ist beständig in Bewegung. Bleiben Sie informiert...
In unserem regelmäßigen Newsletter erhalten Sie aktuelle Fördertipps, Hinweise auf neue Blogartikel, Veranstaltungen und Angebote von Förderlotse.
Checkliste:
Krisenfestes Fundraising beginnt mit der richtigen Analyse
Betroffenheit durch Kürzungen der öffentlichen Hand
Aktueller Stand und Ausblick im Fundraising- und Förderbereich
Strukturen und Ressourcen im Fundraising
Einbindung des Fundraisings in die Organisation
Fachkräfte für Fundraising und Fördermittel:
Persönliche Resilienz
Fundraising-Expertise zeigen: Wie Sie intern Gehör finden und Wirkung entfalten
Diese Checkliste eignet sich im ersten Schritt gut zur Selbstreflexion: Fundraising-Verantwortliche können sie nutzen, um sich einen strukturierten Überblick über die aktuelle Lage zu verschaffen. Oft werden dabei bereits erste Lösungsansätze und Handlungsoptionen sichtbar.
Doch um echte Veränderung anzustoßen, braucht es mehr: den aktiven Dialog mit Kolleg:innen und Entscheidungsträger:innen. Wer diese Gespräche gezielt initiiert, stärkt nicht nur den internen Austausch, sondern auch die eigene Position.
Das Ziel ist klar: Weg von der reaktiven Rolle, in der man als „dauerjammernde Anlaufstelle“ für Notlagen wahrgenommen wird – hin zur proaktiven "Fachexpertin", die Orientierung bietet und konkrete Lösungsansätze einbringt. Dieses Rollenverständnis ist der Schlüssel, um Fundraising in der Organisation strategisch zu verankern und langfristig wirksam zu gestalten.
Mit der Checkliste ins Gespräch: So bereiten Sie den Austausch mit der Führungsebene vor
Wie lässt sich der nächste Schritt ganz konkret gestalten, um mit Führungskräften oder Kolleg:innen in einen zielführenden Dialog zu kommen? Wenn Sie allein für das Thema Fundraising zuständig sind, nutzen Sie die Checkliste als Anlass, gezielt das Gespräch mit Ihrer Führungskraft zu suchen. Arbeiten Sie die einzelnen Punkte strukturiert durch und verwenden Sie Ihre Analyse als Gesprächsgrundlage.
Sind Sie Teil eines Teams oder einer Abteilung, empfiehlt es sich, die Ausgangssituation zunächst gemeinsam mit den Kolleg:innen zu reflektieren. Das so entstandene Gesamtbild liefert eine fundierte Basis für den Austausch mit der Entscheiderebene.
Bitten Sie aktiv darum, die Checkliste gemeinsam durchzugehen – und fordern Sie gezielt die Einschätzung Ihrer Führungskraft ein. Auf diese Weise erhalten Sie nicht nur ein realistischeres Bild Ihrer eigenen Rolle und Leistungen, sondern schaffen auch ein gemeinsames Verständnis für mögliche Entwicklungsschritte.
Wenn Sie das Gespräch gut vorbereitet führen, gelingt es Ihnen im besten Fall, zu jedem identifizierten Problemfeld konkrete Lösungsansätze vorzuschlagen – und Ihre Forderungen auf Augenhöhe zu platzieren.
Vom Gespräch zur strategischen Lösung: Drei Ebenen für konkrete Maßnahmen
Erfahrungsgemäß zeigen sich Handlungsansätze auf drei unterschiedlichen Ebenen:
Kurzfristige Entlastungen („Low hanging fruits“)
Sofort umsetzbare Maßnahmen, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtern – etwa klare Zuständigkeiten, kleine Prozessanpassungen oder einfache Tools zur Priorisierung.
Verbesserung der internen Kommunikation
Absprachen und Strukturen, die dabei helfen, Anfragen an das Fundraising besser zu priorisieren und Transparenz im Team zu schaffen.
Strukturelle Weiterentwicklung
Langfristige Anpassungen an den Anforderungen des Fundraisings, z. B. durch Rollenklärung, Ressourcenplanung oder eine bessere organisatorische Verankerung.
Doch genau hier liegt eine Herausforderung: In Organisationen, die sich im „schwierigen Fahrwasser“ befinden, ist die Bereitschaft gering, langfristige Veränderungsprozesse anzustoßen. Führungskräfte haben wenig Kapazität, Kolleg:innen reagieren oft zurückhaltend auf Grundsatzdiskussionen. Zu groß erscheint der Aufwand, zu ungewiss der Nutzen.
Was es braucht, ist ein pragmatischer, sofort einsetzbarer Ansatz, der erste konkrete Schritte ermöglicht und dabei dennoch hilft, strukturelle Defizite schrittweise anzugehen.
Unsere Lösung von Förderlotse T. Schmotz: Der Finanzierung-Check
Für genau diesen Bedarf haben wir in unserer Beratungspraxis den Finanzierung-Check entwickelt: ein kompaktes, praxisorientiertes Tool, mit dem Sie Prioritäten sichtbar machen, relevante Handlungsfelder identifizieren und konkrete Maßnahmen entwickeln können, ohne alles auf einmal ändern zu müssen.
Tool 2: Finanzierungspotenziale sichtbar machen – die Grundlage für strategische Entscheidungen
Wenn wir Entscheidungsträger:innen dafür gewinnen wollen, die Strukturen und Ressourcen für den Fördermittel- und Fundraisingbereich gezielt zu stärken, müssen wir mit unserer Fachexpertise stichhaltige Argumente und belastbare Daten liefern.
Eine zentrale Aufgabe dabei ist es, die Erfolgsaussichten und das Finanzierungspotenzial der verschiedenen Aktivitäten in Ihrer Organisation sichtbar zu machen – transparent, nachvollziehbar und strategisch. Nur so lassen sich Prioritäten klar benennen und fundierte Entscheidungen treffen.
Zur Orientierung zeigen wir im nächsten Schritt die grundlegenden Bausteine der Finanzierung gemeinnütziger Angebote in einer Grafik:

Neue Förderpotenziale erschließen – mit klarem Ressourcenkonzept
Im nächsten Schritt steht die gezielte Auseinandersetzung mit alternativen Finanzierungsbausteinen im Vordergrund. Für jeden Angebotsbereich Ihrer Organisation sollte geprüft werden, welche weiteren Förderquellen grundsätzlich erschlossen werden könnten. Dazu gehört insbesondere der Ausbau der Fördermittelakquise, etwa durch gezielte Anträge bei Stiftungen, Lotteriemittel oder spezialisierten Fonds.
Ebenso lohnt sich der Blick auf noch ungenutzte Felder des Fördermarkts, wie zum Beispiel thematische Sonderprogramme, europäische Mittel oder Kooperationen mit Unternehmen. Viele Organisationen schöpfen ihr Potenzial in diesem Bereich noch nicht aus, oft nicht aus Mangel an Ideen, sondern an Zeit, Know-how oder strategischer Klarheit.
Entscheidend ist daher auch die realistische Einschätzung, welche Ressourcen erforderlich wären, um neue Finanzierungswege zu erschließen: Braucht es mehr zeitliche Kapazitäten, gezielte Fortbildungen, zusätzliche Fachkräfte oder externe Beratung? Nur wenn diese Voraussetzungen benannt und mitgedacht werden, können neue Förderperspektiven auch tatsächlich realisiert werden.
Diese systematische Betrachtung macht deutlich, wo sich gezielte Investitionen lohnen und wie sich die Zukunftsfähigkeit einzelner Angebote durch eine intelligente Förderstrategie sichern lässt.
Der Finanzierungs-Check für Projekte und Leistungen
Status Quo: Durch welche Bausteine wird das Angebot aktuell finanziert
Fragen zu jedem relevanten Finanzierungsbaustein:
- Wie hoch ist das konkrete Finanzierungsvolumen?
- Welchen Anteil hat der Baustein in der Gesamtfinanzierung?
- Welche Entwicklung ist in der Zukunft zu erwarten?
- Welche Deckungslücke ist zu erwarten?
- Wie dringend muss reagiert werden?
- Lässt sich das Finanzierungsvolumen des Bausteins ausbauen?
Analyseergebnis: In welcher Größenordnung besteht Bedarf an einer alternativen Finanzierung?
Im Fokus: Welche bisher nicht genutzten Finanzierungsbausteine kommen für das Angebot grundsätzlich in Frage?
Bewertung der einzelnen Finanzierungsbausteine:
- Eignet sich die Aktivität grundsätzlich für diesen Baustein?
- Welches Finanzierungsvolumen ist realistisch?
- Wie hoch sind die Erfolgsaussichten?
- Sind Anpassungen am Angebot notwendig?
- Mit welcher Vorlaufzeit ist zu rechnen?
- Welche Ressourcen/welches Investment sind notwendig?
Gibt es die Möglichkeit, einen Baustein, der aktuell für die Finanzierung nicht infrage kommt, in Zukunft zu nutzen (z. B. durch inhaltliche Anpassungen des Konzepts, der Trägerstruktur, etc.)?
Einfluss nehmen: Die öffentliche Förderung aktiv mitgestalten
Öffentliche Mittelkürzungen folgen häufig dem Prinzip des geringsten Widerstands – gekürzt wird dort, wo am wenigsten Protest oder politischer Druck zu erwarten ist. Deshalb lohnt es sich, gemeinsam mit der Führungsebene Ihrer Organisation zu prüfen, ob und wie durch gezielte Lobby- und Netzwerkarbeit Einfluss auf die Förderpraxis genommen werden kann.
Die Beantwortung folgender Fragen hilft Ihnen, die strategische Ausgangslage einzuschätzen:
Die Beantwortung dieser Fragen schafft eine fundierte Grundlage, um zu bewerten, ob eine aktive Interessenvertretung aussichtsreich ist – und wo es sich lohnt, gezielt Ressourcen einzusetzen.
Bewertung: Strategische Relevanz erkennen und priorisieren
Wenn Angebote in finanzielle Schwierigkeiten geraten, eröffnet das auch die Chance, ihre strategische Bedeutung zu hinterfragen. Nicht selten werden Leistungen über viele Jahre hinweg weitergeführt, ohne regelmäßig zu prüfen, ob sie noch zum Profil der Organisation passen oder ob ihre Weiterführung tatsächlich sinnvoll ist.
Gerade in Zeiten rückläufiger Mittel sind gemeinnützige Organisationen gefordert, klarer zu definieren, was ihnen wirklich wichtig ist – und worauf sie künftig verzichten können. Diese Entscheidungen liegen selbstverständlich in der Verantwortung der Führungsebene. Doch Fördermittel- und Fundraising-Verantwortliche können durch gezielte Fragen wichtige Impulse liefern:
Wer die Wirkung eines Angebots belegen kann, schafft eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen und steigert die Förderchancen deutlich.
So bringen Sie den Finanzierungs-Check als internes Beratungsinstrument ein
Der Finanzierungs-Check eignet sich hervorragend, um bei konkretem Finanzierungsbedarf eine sofort nutzbare Entscheidungs- und Priorisierungshilfe für Führungskräfte und Kolleg:innen bereitzustellen. Damit unterstreichen Sie nicht nur Ihre fachliche Kompetenz in der strategischen Fördermittelakquise und im Spenden-Fundraising, sondern tragen aktiv dazu bei, die Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen für nachhaltige Finanzierung innerhalb der Organisation sichtbar zu machen.
Je nach Führungsstil und Meetingkultur Ihres Trägers lässt sich der Finanzierungs-Check flexibel einsetzen, etwa in folgenden Kontexten:
- In regelmäßigen Abstimmungen mit der Leitungsebene, z. B. in Vorstands- oder Geschäftsführungs-Jour-fixes
- In operativen Teams, etwa bei Fachabteilungen oder Ressorts mit direkter Angebotsverantwortung
- Als inhaltlicher Beitrag zu Strategie-Workshops oder internen Tagungen
- Als verbindlicher Arbeitsschritt bei der Entwicklung neuer Angebote, insbesondere mit Blick darauf, frühzeitig die Förderfähigkeit zu prüfen
- Als offenes Format, z. B. in Form einer regelmäßig angebotenen „Fundraising-Sprechstunde“
Mit dem Einsatz des Tools positionieren Sie sich nicht nur als lösungsorientierte*r Fundraising-Profi, sondern schaffen einen strukturierten Rahmen, in dem strategisches Denken und operative Praxis wirkungsvoll zusammenfinden.
Ableitung der strategischen Priorisierung für das Fördermittel- und Spenden-Fundraising
Da die Ressourcen im Fundraising in der Regel begrenzt sind, die Finanzierungsbedarfe aber meist deutlich darüber hinausgehen, stellt sich für jede Organisation früher oder später die Frage: Worauf wollen wir uns im Fundraising konzentrieren?
Die strukturierte Bewertung mithilfe des Finanzierung-Checks ermöglicht es, fundierte Entscheidungen zu treffen:
- Für welche Angebote lohnt sich eine aktive Fundraising-Strategie?
- Wo können alternative Finanzierungsbausteine genutzt werden?
- Und welche Angebote sollten künftig möglicherweise nicht mehr weitergeführt werden?
Solche Entscheidungen sind nie einfach. Aber sie werden deutlich tragfähiger, wenn sie nicht aus der Not heraus, sondern geplant und auf Basis von nachvollziehbaren Kriterien getroffen werden.
Wichtig dabei: Der gesamte Prozess sollte durch transparente Kommunikation begleitet werden. Sobald Entscheidungen getroffen wurden, sollten nicht nur direkt betroffene Personen, sondern alle relevanten Beteiligten informiert werden. Das schafft Verständnis für die Gesamtlage, erhöht die Akzeptanz notwendiger Maßnahmen und signalisiert, dass Fundraising nicht willkürlich „Stop oder Go“ entscheidet, sondern auf Grundlage eines klaren, strategischen Prozesses.
Auch nach außen lohnt sich eine klare, transparente Kommunikation gegenüber Förderern, Unterstützer:innen, Kooperationspartnern oder der Öffentlichkeit. Wer nachvollziehbar vermittelt, warum bestimmte Angebote weitergeführt, angepasst oder beendet werden, schafft Vertrauen und Verständnis und kann in vielen Fällen sogar neue Unterstützung mobilisieren.
Aus der Krise lernen – Fundraising strukturiert weiterentwickeln
Die Erkenntnisse aus dem Finanzierungs-Check sollten nicht nur als einmalige Momentaufnahme dienen, sondern konsequent in ein langfristig tragfähiges Fundraising-System überführt werden. Dazu gehört, dass die Priorisierung von Angeboten und die Einschätzung von Finanzierungsoptionen fester Bestandteil der Jahresplanung und strategischen Steuerung werden.
In größeren und komplexeren Organisationen lässt sich ein solcher Prozess nicht mit einem einzigen Workshop oder einer schnellen Analyse abbilden. Hier empfiehlt es sich, schrittweise vorzugehen, zum Beispiel mit einem Pilotbereich, einer besonders betroffenen Einrichtung oder einem überschaubaren Angebotsfeld.
So kann man Erfahrungen sammeln, Vorgehensweisen anpassen und gleichzeitig Akzeptanz aufbauen, bevor die Methode in andere Bereiche übertragen wird.
Auch der Ressourcenbedarf sollte realistisch eingeschätzt werden: Fundraising-Verantwortliche benötigen für solche Prozesse zeitliche Kapazitäten, methodische Unterstützung und Rückhalt aus der Führungsebene. Aber der Aufwand lohnt sich – weil er zu tragfähigeren Entscheidungen, mehr interner Klarheit und strategischer Wirkung führt.
Nutzen Sie die aktuelle Krisensituation als Impuls, um ein strukturiertes Vorgehen zu entwickeln. Für ein System, das nicht nur kurzfristig entlastet, sondern auch in stabileren Zeiten für verlässliche Mittelbeschaffung sorgt.
Welche Tools und Strategien sind in der Praxis noch hilfreich?
Die Kürzungen öffentlicher Mittel stellen gemeinnützige Organisationen vor beispiellose Herausforderungen. Die in diesem Artikel vorgestellten Tools bieten jedoch praxisnahe Wege, um aus der reaktiven Haltung herauszukommen und stattdessen strukturierte, fundierte Lösungen zu entwickeln.
Indem Sie Ihre fachliche Expertise im Fundraising aktiv einbringen und Entscheidungsprozesse mit klaren Analysen unterstützen, leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur finanziellen Stabilität Ihrer Organisation, Sie stärken auch Ihre eigene Rolle als strategisch denkende Fachkraft.
Der Weg ist nicht immer einfach. Aber mit den richtigen Instrumenten, einem klaren Blick auf die Rahmenbedingungen und einer strategischen Herangehensweise lässt sich auch in schwierigen Zeiten eine nachhaltige Perspektive gestalten.
Wie erleben Sie den Umgang mit diesen Herausforderungen in Ihrer Organisation? Haben Sie eigene Tools oder Ansätze entwickelt?
Ich freue mich, wenn Sie Ihre Erfahrungen und Impulse in den Kommentaren teilen!





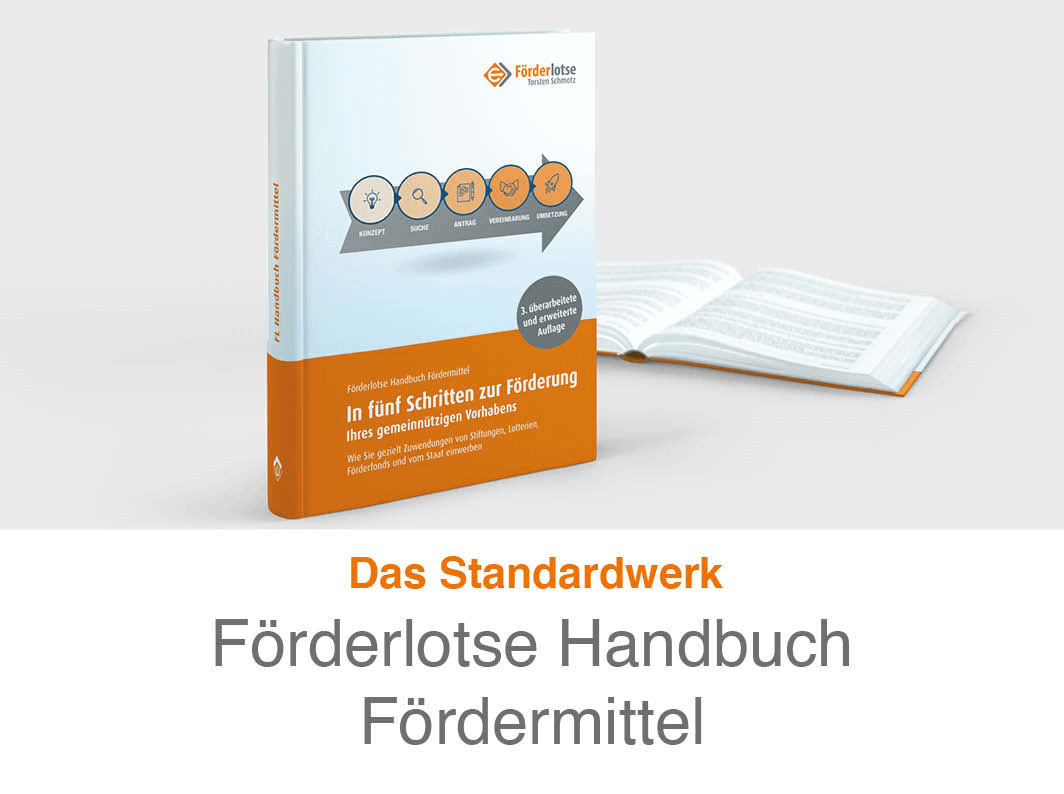
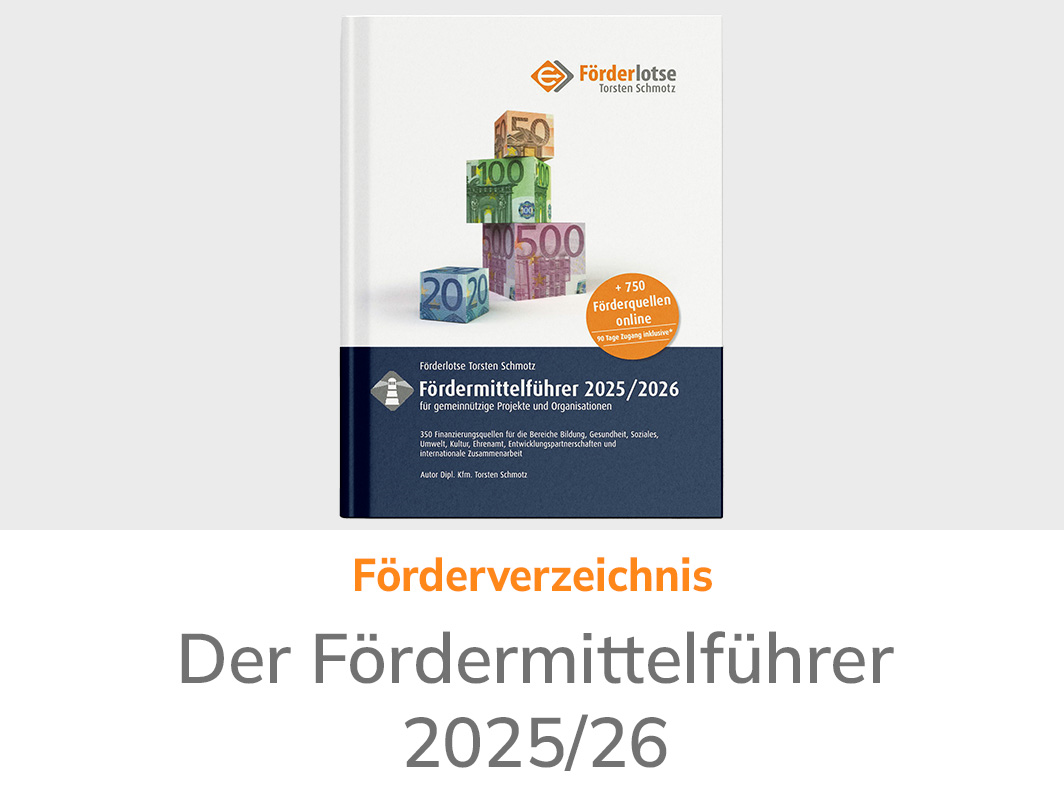



Hallo Herr Schmotz,
vielen Dank für diesen systematischen, fundierten und überaus hilfreichen Artikel. Die beiden Checklisten und die Fragen dazu verhelfen zu zielgerichtetem Vorgehen und zur Einschätzung des eigenen Potenzials bzw. der eigenen Ressourcen. Als Gesprächsgrundlage und um das Fundraising als Thema kontinuierlich in der Organisation lebendig zu halten, empfiehlt sich eine gründliche Bearbeitung der Fragen. Der Finanzierungs-Check als internes Beratungsinstrument ist eine echte Hilfe in der Praxis.
Freundliche Grüße