Die öffentliche Hand zieht sich zunehmend aus der Regelfinanzierung gemeinnütziger Projekte zurück. Die Folge? Verantwortliche für die Fördermittelakquise und das Fundraising geraten massiv unter Druck, diese Finanzierungslücken zu schließen. Doch das Einwerben von Spenden und die Gewinnung von privaten Fördergeldern kann und darf keine universelle Lösung für gekürzte öffentliche Mittel sein.
- Wie können die Verantwortlichen für das Fundraising und das Einwerben von Fördermitteln in solchen Situationen zielführend mit Geschäftsführungen und Kolleg:innen kommunizieren?
- Wie können sie unrealistischen Erwartungen entgegenwirken und trotzdem Lösungsstrategien vorschlagen?
In meinem zweiteiligen Blogartikel gebe ich Einschätzungen und berichte von unseren aktuellen Erfahrungen. In diesem ersten Teil geht es erst einmal um eine genaue Problemanalyse, damit wir im zweiten Teil dann erste Lösungsansätze diskutieren können.
Kürzungen in einem nie dagewesenen Ausmaß
Die Kürzungen der öffentlichen Hand haben ein Ausmaß erreicht, wie ich es in der Vergangenheit bisher nicht erlebt habe. Öffentliche Finanzierungen waren schon immer abhängig von Faktoren wie der Konjunktur, Steuereinnahmen und wechselnden politischen Prioritäten. Doch die Entwicklung der letzten Monate ging weit über das hinaus, was wir bisher gewohnt waren.
Während in der Vergangenheit Mittel für bestimmte Angebote um 10, 20 oder 30 Prozent gekürzt wurden, erleben wir aktuell in vielen Bereichen Reduktionen von 80 Prozent und mehr bis hin zur vollständigen Einstellung der öffentlichen Finanzierung. Die Dramatik dieser Entwicklung hat durch die mehrmonatige Haushaltssperre des Bundes weiter zugenommen.
Besonders alarmierend für mich ist, dass nicht nur freiwillige Leistungen betroffen sind, sondern auch dringend benötigte soziale und therapeutische Beratungs-, Betreuungs-, Pflege- und Teilhabeangebote, bei denen der Staat gesetzlich verpflichtet ist, diese entweder selbst bereitzustellen oder im Rahmen der Subsidiarität durch freie Träger sicherstellen zu lassen. Dabei scheinen dieses Mal alle Bereiche der Sozialwirtschaft betroffen zu sein, egal ob Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Altenpflege, Krankenhauswesen oder der große Bereich der sonstigen sozialen Hilfsangebote.
Eine Kollegin aus der Region Hannover berichtete mir neulich, dass von zehn bestehenden und gut etablierten Angeboten zur sprachlichen und beruflichen Integration nur noch zwei vom Staat weiter finanziert werden, ohne dass sich grundsätzlich am hohen Bedarf etwas geändert hat. Die Folgen kann man sich leider gut ausmalen: Einerseits spart die öffentliche Hand zwar kurzfristig Geld, andererseits entstehen durch eine verzögerte oder gescheiterte Integration neue massive Kosten – und das angesichts des weiterhin herrschenden Fachkräftemangels.
Zuletzt sind schließlich die Mitarbeitenden und die Organisationen der ausgebooteten Träger betroffen. Durch das Streichen der Arbeitsstellen gehen Fachwissen, Engagement und Netzwerke, die wir für diese gesellschaftlichen Aufgaben auch in Zukunft benötigen, verloren.
Wenn man in die Diskussion mit den Verantwortlichen der öffentlichen Hand geht und diese Folgen aufzeigt, wird gerne mit den Schultern gezuckt, da nun mal einfach kein Geld da ist. Man wird mit der Aufforderung konfrontiert, Stiftungen und private Förderinstitutionen anzusprechen, um diese als „Ersatzgeldgeber“ zu gewinnen.
Der Fördermarkt ist beständig in Bewegung. Bleiben Sie informiert...
In unserem regelmäßigen Newsletter erhalten Sie aktuelle Fördertipps, Hinweise auf neue Blogartikel, Veranstaltungen und Angebote von Förderlotse.
Förderinstitutionen unter Druck: Der Ansturm auf Soziallotterien, Stiftungen und private Förderfonds
Diese Entwicklung schlägt jetzt entsprechend bei den privaten Förderinstitutionen auf. Soziallotterien wie Aktion Mensch oder die Deutsche Postcode Lotterie berichten von einer regelrechten Flut an Förderanträgen, die sie kaum noch bewältigen können. Doch nicht nur sie sind betroffen: Auch viele andere Stiftungen, Förderfonds und andere private Geldgeber:innen stehen vor der Herausforderung, mit einer Vielzahl von Anträgen umzugehen, die oft nicht zu ihren eigentlichen Förderrichtlinien passen. Von Betroffenen weiß ich, dass sich die Antragszahlen teilweise verzehnfacht haben!
Viele dieser Anträge sind Ausdruck der Notlage von Projekten, die zuvor durch die öffentliche Hand finanziert wurden und nun um ihre Existenz kämpfen. Die Qualität der Anträge sinkt, weil sie in größter Zeitnot geschrieben werden und die Antragstellenden die Anforderungen der Förderer oft nicht ausreichend beachten.
Das stellt die Förderinstitutionen vor ein Dilemma: Einerseits möchten sie helfen und nachvollziehbare Notlagen abfedern, andererseits sprengen die schiere Menge und die Art der Anfragen oft ihre Kapazitäten und ihren Förderzweck. Viele Stiftungen berichten, dass sie Anträge ablehnen müssen, obwohl die Notwendigkeit der Projekte unbestritten ist – schlichtweg, weil ihre Mittel begrenzt sind. Es gibt aber auch Förderorganisationen, die sich aus der Ausschreibung von Mitteln komplett zurückziehen und nur noch feste Partnern finanzieren, mit denen es bereits längerfristige Beziehungen gibt.
Die Fachkräfte für Fundraising und Fördermittel: Der Erwartungsdruck steigt
Die schwierige finanzielle Lage vieler gemeinnütziger Organisationen verändert die Erwartung gegenüber den Fundraising- und Fördermittel-Verantwortlichen in den letzten Monaten stark. Wo sie früher als Expert:innen für besondere Vorhaben und Projekte sowie den Aufbau und die Pflege von langfristigen Spender- und Förderbeziehungen gesehen wurden, werden sie heute zunehmend als „Feuerwehr für alle Finanzprobleme“ wahrgenommen. Sobald öffentliche Mittel wegbrechen, landen die Probleme auf dem Schreibtisch der Fundraising- und Fördermittel-Abteilung, begleitet von der Erwartung: „Das müsst ihr jetzt irgendwie hinbekommen.“
Organisationen, die bisher Spenden und Fördermittel überhaupt nicht oder nur sehr begrenzt genutzt haben, versuchen nun händeringend entsprechende Strukturen aus dem Boden zu stampfen und sehen sich einem leer gefegten Fachkräftemarkt und gut ausgelasteten Beratungsstrukturen gegenüber.
Die Verantwortlichen für Fördermittel und Fundraising kämpfen damit, dass Geschäftsführungen und Kolleg:innen den Aufwand und die Grenzen des Fundraisings unterschätzen. Diese sehen in der Einwerbung von Spenden und Fördergeldern eine schnell einsetzbare Lösung, ohne sich bewusst zu machen, dass Fundraising kein Selbstläufer ist. Gerade bei Projekten, die eigentlich durch Regelfinanzierungen gedeckt sein sollten, geraten Fundraiser:innen in eine Zwickmühle.
Fördermittel- und Spenden-Fundraising funktionieren nicht als Notnagel
Wenn ich mir die Situation bei vieler unserer Kunden ansehe und mit den Kolleg:innen aus gemeinnützgien Organisationen austausche, lassen sich folgende Herausforderungen festmachen:
- Ein Finanzierungsbedarf ist (noch) kein Fundraising- oder Fördermittelprojekt: Nicht jeder Finanzierungsbedarf lässt sich in ein förderfähiges Projekt übersetzen. Fördermittelgeber:innen und Spender:innen erwarten klar definierte Ziele, Wirkung und eine überzeugende Geschichte hinter dem Projekt. Die bloße Notwendigkeit, eine Finanzierungslücke zu schließen, reicht nicht aus, um die Anforderungen der Förderer:innen zu erfüllen.
- Unrealistische Zeitvorstellungen und Zeitdruck: Häufig wird erwartet, dass Fundraising innerhalb kürzester Zeit Finanzierungsprobleme lösen kann. Doch Fundraising ist ein langfristiger Prozess, der Zeit für Planung, Beziehungsaufbau und Umsetzung benötigt. Die Erwartung, „schnell mal“ eine Finanzierungslücke zu schließen, führt oft zu ineffizienten Ergebnissen, da notwendige Vorarbeiten fehlen.
- Überschätztes Finanzierungspotenzial: Ich bin immer wieder erstaunt, welche unrealistischen Vorstellungen es auf der Ebene der Geschäftsführenden und Vorstände über das Finanzierungspotenzial durch Spenden und Fördermittel gibt. Es ist häufig nicht bekannt, dass das Finanzierungsvolumen durch private Spender:innen und Förderer:innen nur einen Bruchteil der öffentlichen Zuwendungen und Regelfinanzierungen ausmacht.
- Mangelnde Ressourcen für das Fördermittel- und Spenden-Fundraising: In der Regel waren die Fundraising- und Fördermittel-Verantwortlichen schon vor der Krise gut ausgelastet. Wenn nun eine Vielzahl neuer, dringender Finanzierungsprojekte bearbeitet werden soll, reichen die Ressourcen nicht aus.
- Fehlende Priorisierung der Aktivitäten: Es fehlt oft an einer klaren Vorgabe und Absprache darüber, welche Projekte Priorität haben. Viele Geschäftsführende drücken sich hier vor Entscheidungen. Anstatt klar zu sagen, was wichtig ist und was zurückgestellt wird, überlässt man die Fachkräfte mit einem larmoyanten „Sie kriegen das schon hin“ ihrem Schicksal.
- Mangelnde strategische Ausrichtung des Fundraisings: Wenn man sich die Fundraising- und Fördermittelprojekte – durchaus auch von erfahrenen Organisationen und Verbänden – ansieht, fällt mir immer wieder auf, dass die Themen und Schwerpunkte eher zufällig, „historisch gewachsen“ oder durch „persönliche Vorlieben von Entscheidungsträger:innen“ gesetzt werden. Da werden dann Gelder für Aktivitäten eingeworben, die eigentlich auskömmlich anderweitig finanziert sind oder sein könnten, die wenig strategische Relevanz haben oder die man „aus Gelegenheit“ mitgenommen hat. Dadurch geht das Potenzial für wirklich wichtige Angebote verloren.
- Mangelnde strategische Ausrichtung der Gesamtorganisation: Bei unseren Beratungsprojekten fällt uns immer wieder auf, dass auch größere Sozialunternehmen in Bezug auf die langfristige Finanzierung ihrer Aktivitäten keine oder nur eine unzureichende Strategie haben. Angesichts der zurückgehenden Mittel müssen sich Organisationen Klarheit darüber verschaffen, wie, wo, für wen und unter welchen Bedingungen sie ihre Angebote fortführen wollen – und von welchen Bereichen sie sich trennen müssen.
- Spezielle Herausforderung bei bisher regelfinanzierten Angeboten: Solche Angebote erfüllen oft nicht die Förderbedingungen von privaten Förderinstitutionen, die Innovation, neue Angebote, Projekte oder emotionale Geschichten suchen. Vorhaben dürfen in der Regel noch nicht begonnen worden sein, und die bloße Weiterfinanzierung von laufenden Aktivitäten wird ausdrücklich von der Förderung ausgeschlossen. Soziallotterien und Stiftungen möchten nicht als „Lückenbüßer:innen“ einspringen und damit indirekt den Rückzug der öffentlichen Hand unterstützen.
Die politische Dimension des Problems
Ein zentrales Problem im gemeinnützigen Bereich ist die unzureichende Lobby- und Netzwerkarbeit gegenüber politischen Entscheidungsträger:innen. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen, wie etwa der Industrie, der Landwirtschaft oder den Apotheker:innen, sind gemeinnützige Träger und ihre Dachverbände oft deutlich schlechter mit der Politik vernetzt. Dies führt dazu, dass ihre Anliegen in politischen Entscheidungsprozessen weniger Gehör finden und ihre Bedeutung für die Gesellschaft unterschätzt wird.
Hinzu kommt, dass sich gemeinnützige Organisationen und Träger untereinander oft nicht ausreichend abstimmen. Statt geschlossen aufzutreten, lassen sie sich von politischen Akteuren gegeneinander ausspielen: Dann heißt es: „Wenn die AWO das nicht mehr zu unseren Konditionen macht, dann übernehmen das gerne die Kolleg:innen von der Diakonie oder vom DRK.“
Man könnte meinen, dass die gemeinnützigen Landes- und Bundesverbände sowie die Kirchen angesichts dieser Lage massiv in die Bereiche Fundraising und Fördermittelgewinnung investieren und ihre Lobbyarbeit verstärken. In meiner Wahrnehmung ist leider häufig das Gegenteil der Fall. Kürzungen werden nach der Rasenmäher-Methode pauschal auf alle Bereiche angewendet, egal ob sie einen Beitrag zur finanziellen Entlastung leisten können oder nicht.
Es bleibt bedauerlicherweise bei der traurigen Wahrheit: Bei zurückgehenden Mitteln wird der Rotstift da angesetzt, wo am wenigsten Widerstand erwartet wird.
Emotionale Belastung und Frustration
Die aktuellen Entwicklungen belasten Fundraising- und Fördermittel-Verantwortliche auch emotional. Sie erleben hautnah, wie dringend benötigte Angebote eingestellt werden müssen und wie Zielgruppen – ob Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder Geflüchtete – plötzlich ohne Unterstützung dastehen. Besonders schwer wiegt es, wenn Kolleg:innen ihre Arbeitsplätze verlieren, weil keine ausreichende Finanzierung gefunden werden kann.
Formate zum Austausch und zum Netzwerken mit Gleichgesinnten gibt es einige im Fördermittel- und Fundraisingbereich. Nutzen Sie den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen, um sich über die aktuelle Situation auszutauschen. Einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten finden Sie hier: Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote im Fördermittel - Fundraising - Blog-Förderlotse
Hinzu kommt die Frustration, wenn trotz größter Bemühungen keine ausreichenden Mittel eingeworben werden können. Man macht sich selbst Vorwürfe oder es gibt im schlimmsten Fall Vorwürfe der „Inkompetenz“ und des „mangelnden Einsatzes“. Viele Fundraiser:innen fühlen sich von den Geschäftsführenden alleingelassen, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt wird oder ihnen die notwendigen Ressourcen fehlen. Die oft unrealistischen Erwartungen verstärken diesen Druck zusätzlich. Diese emotionale Belastung kann langfristig zur Erschöpfung und Resignation führen.
Was sind Ihre/Eure Erfahrungen?
Die Entwicklung von Lösungsansätzen erfordert eine genaue Problemanalyse. Die wollen wir im 2. Teil des Artikels vorstellen.
- Deckt sich meine Einschätzung mit Ihren/Euren Erfahrungen in den Organisationen und Verbänden vor Ort?
- Gibt es weitere Aspekte, die eine wichtige Rolle spielen?
Bitte schreibt/schreiben Sie dazu einen Kommentar.


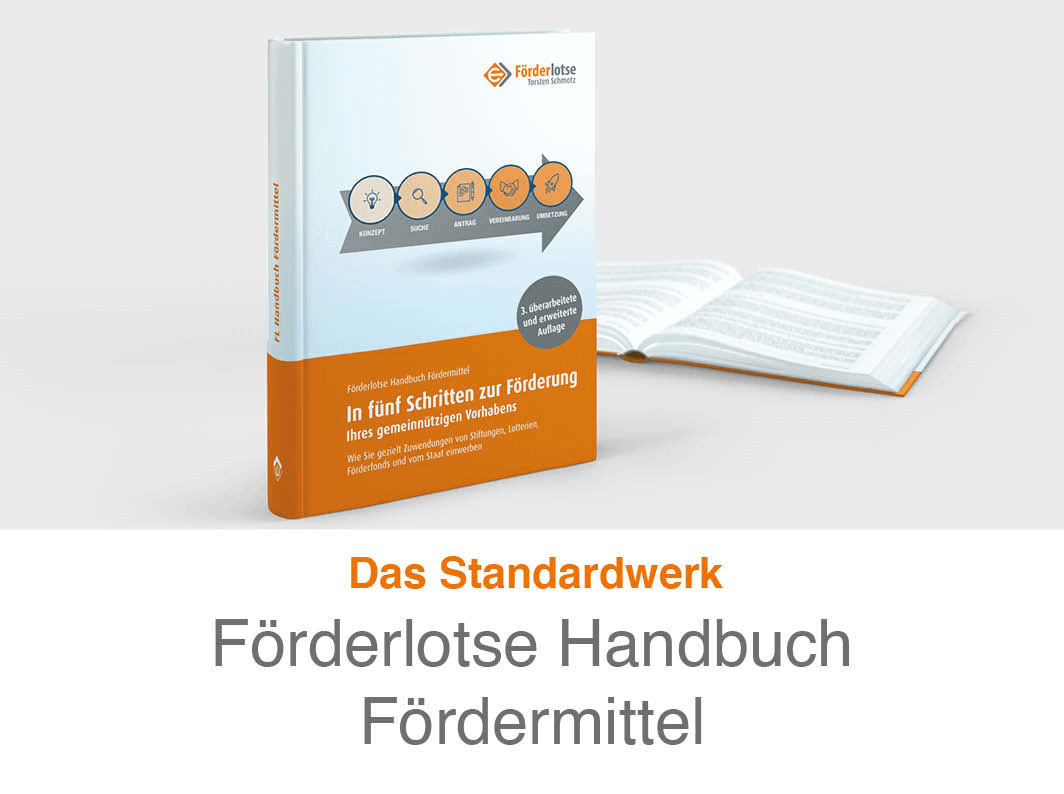
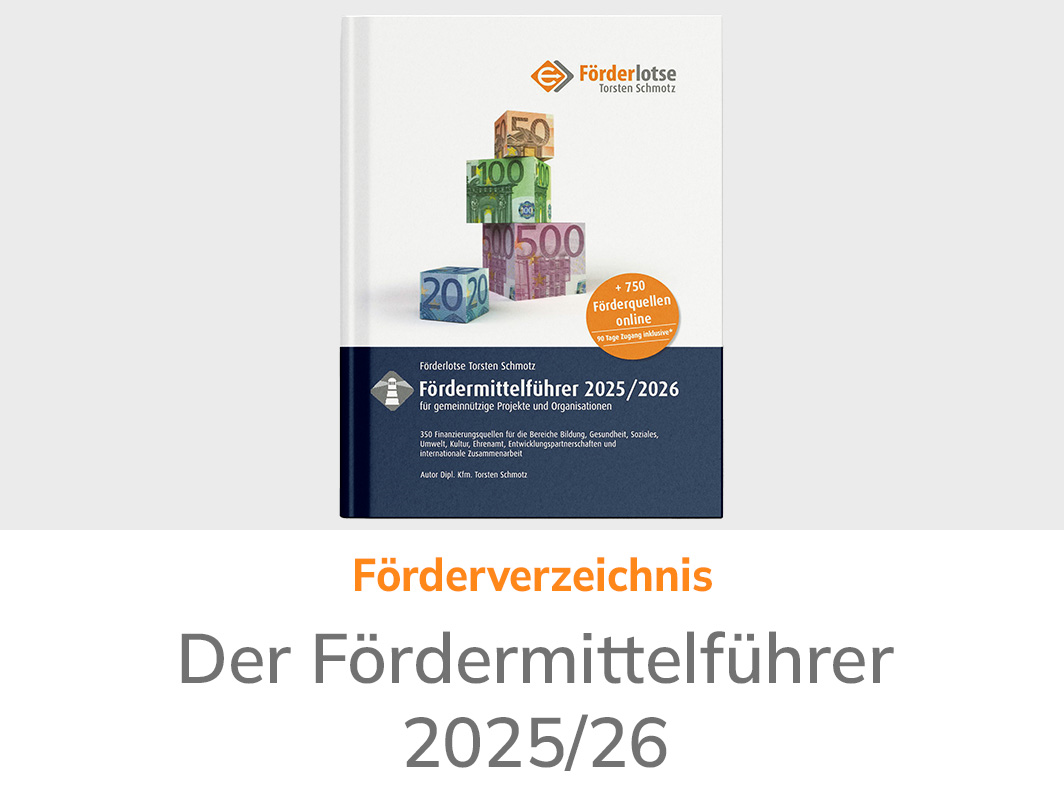


Hallo Herr Schmotz,
ein sehr guter und das sich verschärfende Dilemma aufnehmender Artikel. Danke.
Ich denke, das von Ihnen angesprochene Thema Strategie, Planungen und Weiterentwicklung von Geschäftfeldern ist wichtig. Auch die Teilfinanzierung von bestehender Infrastruktur (Immobilien, Fahrzeuge, etc.) kann unter Umständen entlasten.
Inwieweit vor dem Hintergrund der wegfallenden öffentlichen Mitteln für Regel- und immer mehr auch Freiwilligkeitsleistungen, die Möglichkeit besteht innovative Projekte zu entwickeln, erscheint mir sehr schwer umzusetzen. Eventuell müssen auch die privaten Fördermittelgeber an dieser Stelle auf die geänderte Situation reagieren.
Beste Grüße
Marc Girrbach
Hallo Marc Girrbach, danke für die Rückmeldung. Deine Einschätzung in Bezug auf innovative Projekte kann ich gut nachvollziehen. Ich bekomme vereinzelt mit, dass auf Seiten der Förderer da entsprechende Diskussionen schon laufen. Bin gespannt auf die Ergebnisse.
Hallo Torsten Schmotz,
vielen Dank für diesen umfassenden und focussierten Artikel. Er deckt sich sehr mit unseren Erfahrungen als regelmäßiger und häufiger Antragssteller udn von kommunalen Kürzungen betroffene kleine Organisation!
Ich und wir teilen auch sehr ihre Einschätzung der politischen Dimension und haben schon die Konsequenz gezogen, uns mehr gesamtgesellschaftlich, aber auch lobbymäßig zu engagieren.
Viel Glück allen, die so unterwegs sind!
Lieber Uwe Fischer, danke für Dein Feedback und das Teilen Deiner Erfahrungen.
Vielen Dank, für diesen ausführlichen Blogbeitrag. Die aktuellen Herausforderungen für uns im Gesundheitswesen sind enorm. Die von Ihnen im Blog dargestellte Themen weisen auf große Aufgaben hin, die nachhaltige Lösungen erfordern, und es wird mal wieder deutlich, dass Fundraising kein kurzfristiges Notprogramm sein darf, sondern eine strategische Aufgabe, die langfristig geplant werden muss. Danke für die wertvollen Einblicke – ich freue mich auf die Diskussion im zweiten Teil!
Liebe Ulrike, danke für Deine Rückmeldung.
Vielen Dank für diesen tollen Blogbeitrag, vieles darin erlebe ich ähnlich in unserer Organisation und bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Organisationen. Ich freue mich auf Teil zwei.
Hallo Herr Schmotz,
auch von mir vielen Dank für Ihren Artikel. Ich bin zwar kommunaler Fördermittelmanager, kann aber bestätigen, dass die von Ihnen beschriebene Problematik auch uns als kommunale Institution immer häufiger betrifft. Auch uns als relativ kleine Kommune fällt es immer schwerer öffentliche Fördermittel einzuwerben. Häufig sind die Förderbedingungen so anspruchsvoll, dass wir sie weder fachlich, noch organisatorisch und finanziell (Eigenmittel) stemmen können. Im Bereich der EU-Förderung für ländlichen Räume werden mittlerweile 2/3 der Anträge abgelehnt. Nicht der Qualität wegen, sondern weil die Mittel immer weiter gekürzt werden.
Auch kann ich bestätigen, dass auf der Entscheidungsebene nicht immer der Sinn und Zweck von Fördermitteln bekannt ist. Hier herrscht häufig noch immer die Überzeugung, dass es für alles Fördermittel gibt. Auch wir versuchen zunehmend für unsere Projekte Spenden über Stiftungen einzuwerben. Wobei wir als öffentliche Institution häufig nicht antragsberechtigt sind. Das macht es für uns noch schwerer. Der Austausch mit den entsprechenden Ansprechpartnern bestätigt das zunehmend hohe Antragsaufkommen. – Ich bin gespannt auf weitere Rückmeldungen aus der Runde der Fördermittelmanager zu der Problematik.
Beste Grüße
Richard Finke
Hallo Herr Finke, vielen Dank für Ihre ehrliche Rückmeldung aus der Perspektive der kommunalen Fördermittelmanager. Am Ende sitzen wir ja alle im gleichen Boot.