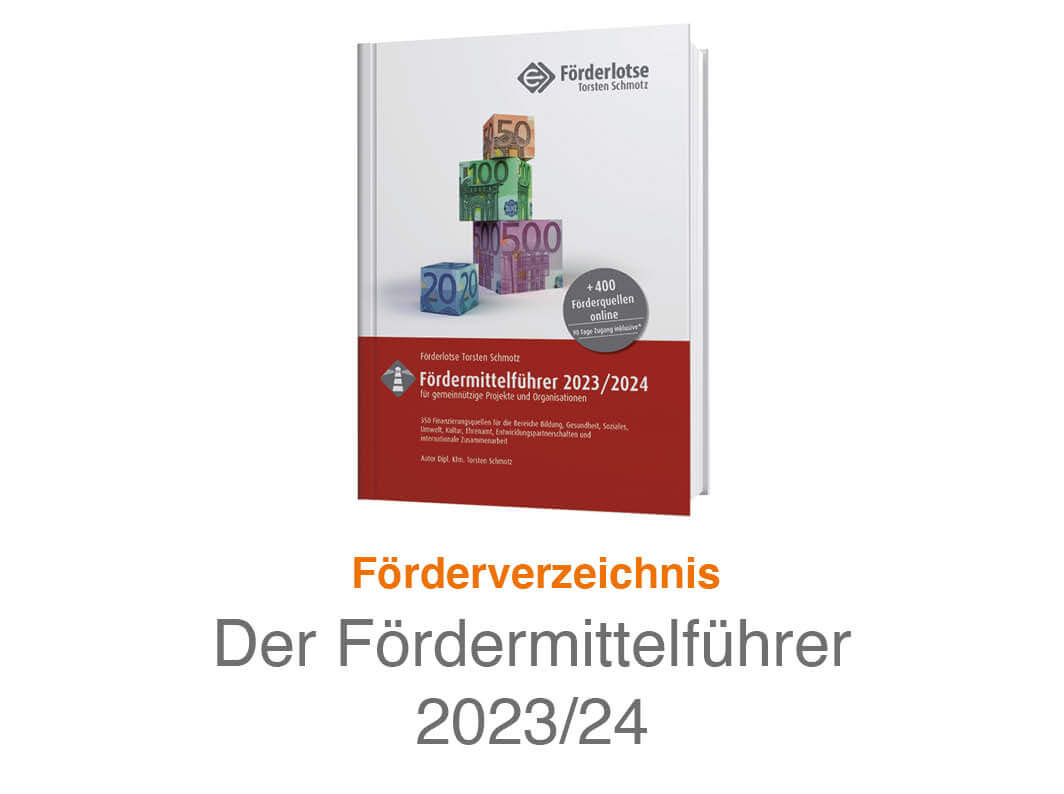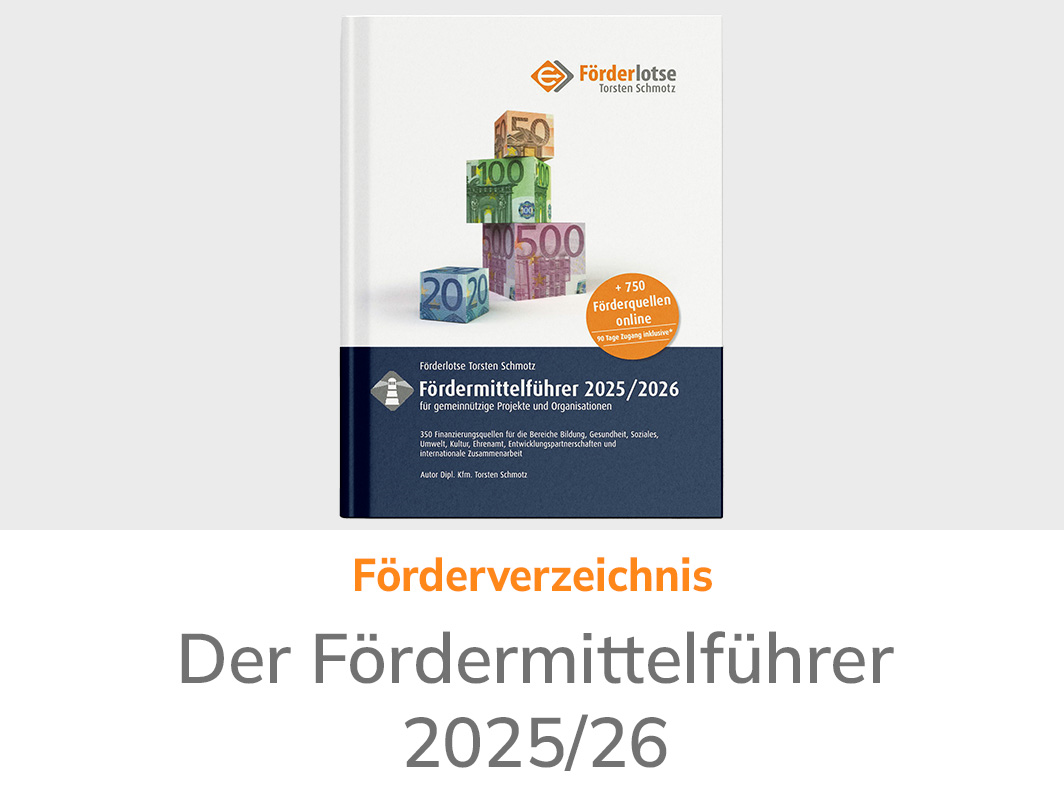In diesem ersten Teil meiner vierteiligen Blogserie zur öffentlichen Förderung für gemeinnützige Aktivitäten in Deutschland erhalten Sie einen Überblick über die kommunalen Fördermöglichkeiten.
In den weiteren Artikeln der Blogserie "Öffentliche Förderung" geht es in Teil 2 um die Förderzugänge über die Bundesländer sowie in Teil 3 um die Möglichkeiten der Förderung durch den Bund. In Teil 4 gebe ich Ihnen einen Überblick der wichtigsten Begrifflichkeiten in der Zusammenarbeit mit Förderern der öffentlichen Hand, die Sie bei Ihrer Fördermittelakquise unterstützen werden. Zudem erhalten Sie in meinem Beitrag Die staatlichen Zuschüsse im Überblick wichtige Hintergrundinformationen zur öffentlichen Förderung sowie weiterführende Hinweise für gelingende Förderpartnerschaften mit der öffentlichen Hand.
Die Kommunen als eine Ebene der öffentlichen Förderung
Die Gemeinden, Städte und (Land-)Kreise auf der untersten Ebene sind für die Grundversorgung der Bevölkerung vor Ort zuständig. Mit Stand Januar 2024 gibt es 10.753 Gemeinden in Deutschland, diese unterteilen sich in 2.056 Städte und 8.697 Gemeinden ohne Stadtrecht. In einigen größeren Bundesländern gibt es darüber hinaus Regierungsbezirke, Landschaftsverbände o. Ä., die überregionale Themen unterhalb der Landesebene koordinieren sollen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Landschaftsverband Westfallen-Lippe. Baden-Württemberg wiederum ist in vier Regierungsbezirke unterteilt (Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Tübingen). In den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin sind dafür wiederum die Stadtbezirke relevant.
Einen Überblick zu den föderalen Strukturen und die dazugehörige Förderpolitik habe ich Ihnen im Opener zu dieser Blogserie zusammen gestellt. Der Artikel Öffentliche Förderung: Die staatlichen Zuschüsse im Überblick gibt Einblicke in die Strukturen und Förderstrategien der einzelnen Ebenen der öffentlichen Hand.
Direkt vor Ort: kommunale und regionale Förderung
Prinzipiell sind die Kommunen der erste Ansprechpartner für gemeinnützige Projekte. Attraktive Aktivitäten in den Bereichen Soziales, Sport, Umwelt, bürgerschaftliches Engagement und Kultur sind den Gebietskörperschaften oft ein großes Anliegen. Meist bestehen zwischen den Trägern und der Verwaltung langjährige und vertrauensvolle Beziehungen.
Wie das konkret aussieht, kann man sich am Beispiel einer Kommune genauer ansehen. Ich habe aus dem städtischen Haushalt meiner Nachbarstadt Ansbach einmal den Bereich der freiwilligen Zuwendungen zusammengestellt. Dabei wird sichtbar, wie vielfältig das Förderspektrum ist, auch wenn Ansbach eher zu den ärmeren Kommunen in Bayern zählt.
Der Fördermarkt ist beständig in Bewegung. Bleiben Sie informiert...
In unserem regelmäßigen Newsletter erhalten Sie aktuelle Fördertipps, Hinweise auf neue Blogartikel, Veranstaltungen und Angebote von Förderlotse.
Praxisbeispiele: Förderprogramme von Kommunen
Städte und Gemeinden können ihre Förderung auch in Form von eigenen Förderprogrammen ausschreiben, wie die folgenden Beispiele veranschaulichen:
- Laut den Richtlinien für Zuschüsse der Stadt Gersthofen an die Ortsvereine erfolgt eine Unterstützung der Vereine im Ortsgebiet in Form von laufenden Zuschüssen, Mietzuschüssen, Zuschüssen für besondere Anlässe und Leistungs- und Investitionszuschüssen.
- Das Förderprogramm Altstadt Marktbreit hat die Erhaltung des ortstypischen, eigenständigen Charakters des Ortsbildes der Altstadt Marktbreit im Fokus.
- Einzelne Förderprogramme der Stadt Biberach im Bereich Umwelt- und Klimaschutz unterstützen Umweltschutzmaßnahmen wie »Grün in der Stadt«, »Bau von Regenwasseranlagen«, »Thermischer Solarbau«, »Wärmedämmung am Altbau« und »Modellhafte Energieprojekte«.
- Der Förderschwerpunkt für freie Kunst und Kultur der Stadt Leipzig konzentriert sich auf den Erhalt von Vielfalt und Qualität des vorhandenen Angebots und verstärkte Förderung neuer, innovativer Projekte.
- Um die Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart bestmöglich bei der Energie- und Klimawende zu unterstützen, fördert die Stadt Stuttgart viele verschiedene Klimaschutzmaßnahmen: Von Zuschüssen für die energetische Sanierung von Gebäuden und für zukunftsfähige Mobilitätsformen bis hin zu Förderungen für Urban Gardening- und Begrünungs-Projekte.
Ansprechpartner für Fördermittel auf kommunaler Ebene
Wen soll ich aber jetzt mit meinem Projekt konkret anfragen, wenn es keine direkt ausgeschriebenen Förderaufrufe gibt? Die ersten Anlaufstellen sind das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters oder die entsprechende Regierungsdirektion. Sie haben z. T. eigene Mittel, können bei Bedarf aber natürlich auch auf andere zuständige Stellen verweisen.
Die Verwaltung ist meist nach Themen und Zielgruppen organisiert. Man findet Dezernate und Abteilungen zu den Themen Bildung, Schule, Sport, Soziales, Wohnen, Wirtschaft, Migration, Kultur, Umwelt usw. Daneben sollte man auch den Kontakt zu den Entscheidungsgremien pflegen, wie Gemeinde- und Stadträte, Kreis- und Bezirkstage.
Im Vergleich zu den häufig wechselnden Zuständigkeiten auf Landes- und Bundesebene sind die Verantwortlichkeiten im kommunalen und regionalen Umfeld meist sehr stabil geordnet. Wenn man sich einmal einen Überblick über sein Thema in seinem Umfeld verschafft hat, muss man nach der nächsten Wahl mit Regierungswechsel nicht gleich wieder von vorne beginnen. Folgende Grafik gibt einen Eindruck, wie die Verwaltung einer Gemeinde organisiert sein kann:Zuständigkeit für Zuschüsse auf Stadtteilebene
Bei größeren Städten werden bestimmte Aufgaben auf die Stadtteile übertragen. Die Münchener (Stadt-)Bezirksausschüsse fördern im Rahmen von Stadtbezirksbudgets stadtteilbezogene Anliegen der Bürger. Zuwendungen beantragen können Initiativen, Gruppen oder sonstige Organisationen, die in den Bereichen Kultur und Kunst, Jugend und Soziales, Schule, Sport und Spiel, Gesundheit und Umwelt das Gemeinschaftsleben ihres Stadtbezirks durch interessante Aktionen und Projekte gestalten und bereichern wollen. Häufig gibt es Zuschüsse zur Weihnachtsfeier, zum Sommerfest, zu Seniorenfahrten, zu Gewaltprävention an Schulen und anderen Schulprojekten oder zur Erstausstattung in Kinderinitiativen. Einige Bezirksausschüsse haben die Zuschüsse begrenzt (300 bis 3.000 Euro), andere fördern auch Vorhaben in einer Größenordnung von 15.000 bis 20.000 Euro. Eine Zuwendung wird erfahrungsgemäß eher bewilligt, wenn ein Eigenanteil (25–50 %) bei der Finanzierung eingeplant ist.
Zuwendungen von der Kreisebene
Wenn es sich bei Ihrer Kommune nicht um eine kreisfreie Stadt handelt, übernimmt der (Land-)Kreis bestimmte Aufgaben auf überkommunaler Ebene. An der Spitze stehen eine Landrätin oder ein Landrat und der Kreistag. Viele Kreistagsabgeordnete sind in Doppelfunktion tätig, da sie auch auf kommunaler Ebene (beispielsweise als Bürgermeisterin oder Bürgermeister) aktiv sind. Typische Aufgabengebiete der Kreise sind Sozialleistungen (Sozial-, Alten- und Jugendhilfe, Krankenhäuser), Kultur (Volkshochschulen, Museen) oder weiterführende Schulen. Auf den Newsseiten der Kreistage kann man sich über aktuelle Förderungen informieren, z. B.:
Kommunen verteilen nicht nur das eigene Geld!
Es gibt in Deutschland natürlich auch Kommunen, die so stark verschuldet sind, dass sie keine freiwilligen Leistungen mehr übernehmen können. Das ist aber kein Grund, keine entsprechenden Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Kommunen verteilen nämlich nicht nur ihr eigenes Geld. Viele Förderprogramme werden aus den Haushalten der Länder, des Bundes und auch der Europäischen Union getragen, die örtliche Kommune ist dann aber für den Einsatz vor Ort zuständig.
Gute Beispiele sind die Förderprogramme für den Städtebau und Regionalentwicklung. Hier muss in der Regel die Kommune zuerst selbst aktiv werden und die örtlichen Bedarfe koordinieren. Bei der Umsetzung werden die Fördergelder dann häufig direkt an Kooperationspartner weitergeleitet, z. B. einen gemeinnützigen Verein.
Einige Förderbeispiele für Stadt- und Regionalentwicklung sind:
- Förderprogramme für Land und Stadt in NRW
- Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen
- Strukturentwicklung im Ländlichen Raum Baden-Württemberg
- Förderprogramm Regionalbudget Region Kassel-Land
In vielen ländlichen Regionen spielt das europäische Förderprogramm LEADER eine wichtige Rolle. Die Initiative für eine grundsätzliche Beteiligung muss dabei von den örtlichen Kommunen ausgehen, die sich zu lokalen Aktionsgruppen zusammenfinden müssen.
Beispiele für LEADER-Förderprojekte sind:
- Älter werden in vertrauter Umgebung – Unternehmerin schafft neue Senioren-Angebote
- Erlebnis- und Naturgarten für den Kindergarten Außernzell
- Inklusive Region Oberes Volmetal
- Keltischer Donnersberg - keltisches Erlebnis- und Informationszentrum auf dem Donnersberg
Hier können Sie recherchieren, ob Ihre Gemeinde Teil einer LEADER Region ist.
Ich habe es häufig erlebt, dass gerade Kommunen, die selbst keinen finanziellen Spielraum mehr haben, sehr engagiert sind, andere Fördermöglichkeiten für sich und die örtlichen Träger zu erschließen. Der Bund hat sogar ein eigenes Förderprogramm "Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen"
Nachhaltige Partnerschaft: Kommunen und gemeinnützige Träger
In der Regel brauchen die Kommunen die lokalen gemeinnützigen Akteure, um entsprechende Dienste und Hilfen anbieten zu können. Damit sind Sie bei der Frage nach zusätzlichen freiwilligen Fördermitteln im Idealfalls ein langjähriger und kompetenter Partner für Ihre Gemeinde. Ein weiterer Effekt solch einer Zusammenarbeit kann die gemeinsame Arbeit in einem Projekt darstellen. Bei etlichen Förderprogrammen sind nur Kommunen antragsberechtigt, so dass Sie als gemeinnütziger Akteur im Rahmen eines Kooperationsprojekts indirekt von weiteren Fördertöpfen profitieren können. Häufig spielen hier thematisch der Quartiersansatz und die Sozialraumorientierung eine wichtige Rolle. So auch zum Beispiel im baden-württembergischen Förderprogramm „Quartiersimpulse“. Dieses richtet sich an Städte, Gemeinden und Landkreise, die in Baden-Württemberg mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung Projekte zur alters- und generationengerechten Entwicklung von Quartieren, Stadtteilen und Ortschaften durchführen möchten. Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden sowie kommunale Verbünde. Landkreise sind in Kooperation mit mindestens einer kreisangehörigen Kommune ebenfalls antragsberechtigt. Gemeinnützige Organisationen, als ein wichtiger Player im jeweiligen Quartier, müssen hier natürlich mit bedacht werden.